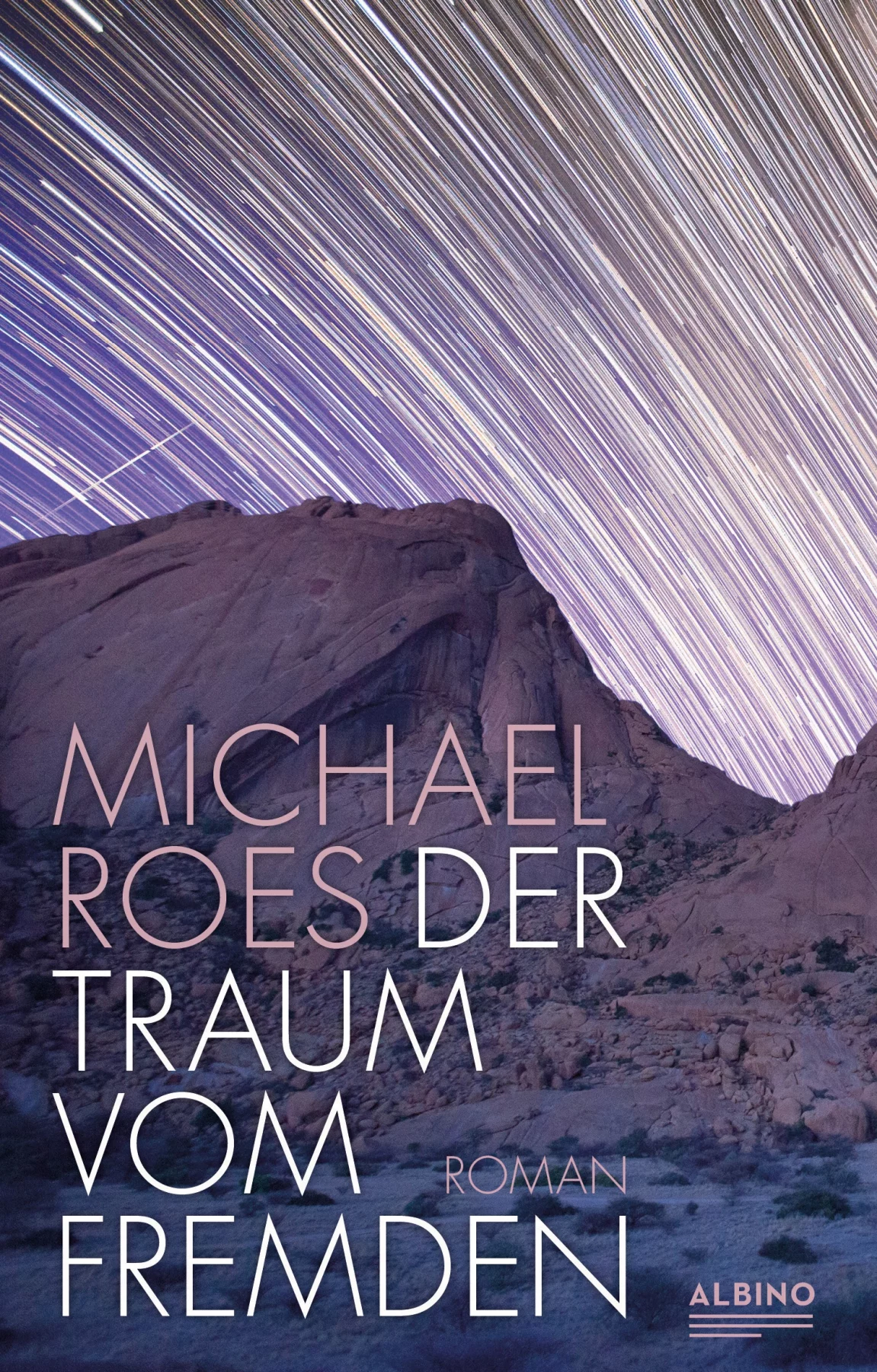
Der Traum vom Fremden
von Michael Roes
Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen, 264 Seiten
Veröffentlchung: September 2021
Der Traum vom Fremden
Ostafrika 1883: Arthur Rimbaud, der große Poet der Dritten Französischen Republik, hat dem Dichterleben abgeschworen und arbeitet als Kaffee- und Waffenhändler in der legendären Stadt Harar. Als sein Geschäftspartner Sotiro von einer Erkundungsreise in den Ogaden nicht mehr zurückkehrt, startet Rimbaud eine Rettungsmission. Mit einer kleinen Mannschaft vertrauter Einheimischer dringt er vor in die noch unerforschte Wildnis des Ogaden, wo ihn unerwartet die Poesie einholt. Während der Dichter, der keiner mehr sein will, die gefahrvolle Expedition möglichst nüchtern und wissenschaftlich zu protokollieren versucht, drängen immer öfter die längst vergessen oder überwunden geglaubten Dämonen der Vergangenheit zurück in sein Bewusstsein.
Als Grundlage für Der Traum vom Fremden dient ein authentischer Bericht, den Rimbaud 1883 über den Ogaden verfasste. Ausgehend von diesem ungewohnt sachlichen Rimbaud-Text taucht Michael Roes ein in die Gedankenwelt des französischen Poeten und lässt ihn Bilanz ziehen. Philosophische Reflexionen über das Reisen, das Dasein und das Schreiben wechseln sich ab mit fiebrigen Erinnerungen an die Amour fou mit Paul Verlaine, Rimbauds kaum erforschte Zeit bei der Fremdenlegion und seinen Neuanfang in Afrika. So ist Der Traum vom Fremden Entdeckerroman und poetisches Experiment zugleich.
BIOGRAFIE
MICHAEL ROES, geboren 1960 in Rhede / Westfalen, ist Autor und Filmemacher. Er verfasste zahlreiche Romane, Theaterstücke und Gedichte, schuf mehrere filmische Essays und dokumentarische Spielfilme. Eine zentrale Rolle in seinem Werk spielen Dialoge mit nicht-europäischen Kulturen. Reisen in den Jemen, nach Israel, Algerien, Afghanistan und Mali bilden den Hintergrund für viele seiner Werke. Sein Roman „Die Laute“ war 2012 für den Deutschen Buchpreis nominiert, 2020 erhielt er den Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis für sein literarisches Gesamtwerk. Michael Roes lebt in Berlin.
LESEPROBE
Auszug aus „Der Traum vom Fremden“ von Michael Roes
Mittwoch, den 10. Oktober 1883. Wer in diesen kargen südlichen Ländern unterwegs ist, altert schneller: die Sonne trocknet die Haut aus, Gesicht und Handrücken röten sich, werden braun, dann schwarz wie altes Leder, nach stundenlangem Reiten ist der Hintern wund, sind die Beine taub, daß man kaum noch von seinem Maultier steigen kann, ohne einfach zu Boden zu stürzen; was weich ist, wird hart, schorfig, Fett schwindet, Sehnen treten hervor, und am Ende ist es, als würde der ganze Körper ausgetauscht und in einen neuen, härteren, vielleicht auch wahreren wechseln und das ganze falsche Weiß und alle Sanftheit wie eine abgestreifte Haut zurücklassen.
Die beiden Franziskaner sind noch ganz im Zustand der Wundheit und Häutung, während M. Brémond bereits ein neues Gleichgewicht zwischen Lethargie und Grausamkeit erlangt hat. Unter seinen schweren, teigigen Lidern scheint er zu dösen, doch ein gelegentliches Aufblitzen zeigt, daß ihm nichts in seiner Umgebung entgeht. Bei mir wuchs das Barthaar immer nur spärlich, bei den anderen aber sehe ich den offenkundigen Wandel auch am voranschreitenden Zuwuchern ihrer zu Beginn der Reise noch hellen und offenen Gesichter. Den größten Teil des Weges sind sie inzwischen stumm, nicht, weil bereits alles gesagt wäre, sondern aus Erschöpfung, aus Furcht, die Schmerzen in jedem Muskel, jeder Faser könnte Laut werden und den um Haltung Bemühten der Lächerlichkeit preisgeben. So sind wir denn eine Karawane von Tieren mit unnatürlich steifen, wort- und blicklosen Lasten.
Nach den kargen Hängen wird die Landschaft sanfter, zwischen dem graubraunen Geröll finden sich einige alte, windzerzauste Akazien, dickstämmige Aloe mit leuchtendgelben Blütensträußen und ein Kraut, das Hadsch Afi harmal nennt, uns und die Tiere indes von dem niedrigen Gewächs fernhält, da es giftig sei. Schließlich löst rak das giftgrüne Kraut ab, ein Busch mit eßbaren, dunkelvioletten Beeren. Die Einheimischen fertigen aus den dicken Ästen dieser Pflanze ihre Zahnbürsten, indem sie ein fingerlanges Stück abschneiden und das Ende mit den Zähnen ausfransen.
Die Kamele fressen diese rak-Zweige mit großer Gier, obwohl sie durchaus wissen, daß ihr Verzehr anhaltende Durchfälle hervorruft. In der Folge, die auch wir zu spüren bekommen, bespritzen die unablässig hin und her peitschenden Schwänze das Gepäck, den Reiter und die nebenher Gehenden mit grünem Kot, und bis zum nächsten Bade wird der Reisende den rak-Geruch nicht mehr los. Und wer die Milch einer Kamelstute trinkt, die sich ausgiebig am rak-Strauch gelabt hat, erlebt an sich selbst die heftig abführende Wirkung dieser Pflanze.
Endlich tauchen die Grashütten Bubassas hinter einem kargen Hügel auf. Nie ist ein Europäer (vor Sotiro) weiter gen Süden vorgedrungen als bis hierher. Tierhäute warten auf uns, doch werden wir uns erst auf unserem Rückweg darum kümmern können.
Meine sterbenswilligen Begleiter, die von der drohenden Gefahr beseelten Missionsbrüder, singen ein aus reinen Kehlen aufsteigendes engelhaftes Lied, das so gar nicht in die schroffe Landschaft passen will und sogleich alle Schakale in der näheren Umgebung in die Novene einfallen läßt.
Bubassa ist nicht viel mehr als ein kleiner Marktflecken mit wenigen stallgleichen Lehmkaten, der nur an den Markttagen zu gewissem Leben erwacht. Dann werden Gestelle mit Dächern aus Flechtwerk errichtet, die den zusammenströmenden Menschen und Tieren einen leidlichen Schutz gegen die Sonne gewähren, während Händler und Käufer um das eine wie das andere feilschen. Obgleich die Ägypter nach ihrer Besetzung Harars sogleich den Menschenhandel verboten haben, reicht ihre Amtsgewalt kaum über die Stadtmauern hinaus. Und ob nun einer ein Diener mit geringem Lohn oder ein Sklave mit freier Kost und Unterkunft ist, läßt sich kaum mit Sicherheit sagen, solange der Betreffende sich nicht beklagt. Selbst in unserer Karawane wüßte ich nicht, wer von den Trägern Brémonds ein Lohnknecht und wer ein Sklave wäre. Brémond behandelt sie alle gleich schlecht.
In Bubassa stehen wir unter dem Schutz des boko Seyfou Galla, des Scheichs dieses Weilers; nennen zwei Handelsplätze an verschiedenen Enden des Ortes unser Eigen; bezahlen vier Stammeskrieger für den Schutz unserer südlichsten Handelsniederlassung. Die ersten vier, die Scheich Seyfou uns gestellt hat, waren Diebe. Wen wundert’s, da Scheich Seyfou den für die Wächter bestimmten Lohn selbst eingestrichen hat. Nachdem Sotiro und ich dem boko Beweise für die Schwindsucht unserer Waren vorgelegt haben, ließ er seine untreuen Krieger verstümmeln (kastrieren) und davonjagen. Ein unbekanntes Fieber fesselte Sotiro und mich bei unserem letzten Besuch in Bubassa ans Lager, so daß wir diese Grausamkeit nicht haben verhindern können.
Er stammt von Rhodos, wie so viele andere griechische Kaufleute in Afrika. In den langen ereignislosen Hararer Nächten spricht er manchmal, wenn auch einsilbig, von der Kreuzfahrerinsel, als sei er selbst ein Nachfahre der Johanniter. Sobald er genügend Geld zusammen habe, wolle er heimkehren und sich gleich im Schatten der mächtigen Festungsmauern eine Villa im klassischen Stil errichten. Ich wünsche ihm dabei viel Erfolg, denn wesentlich zahlreicher als diejenigen, die in die Heimat zurückkehren, sind jene, die in Afrika der Hitze, den Krankheiten, den Überfällen oder gar der Versklavung anheimfallen. Diesmal aber soll sein Schicksal noch nicht entschieden sein: ich will alles tun, meinen Geschäftsfreund aus seiner unglücklichen Lage zu befreien. Indes habe ich unsere Maria-Theresien-Taler in Harar gelassen. Sie hätten ohnehin nicht gereicht, das unverschämte Lösegeld zu bezahlen. Offenbar halten die hiesigen Menschenräuber alle Europäer im Lande für die Gebrüder Rothschild. Gewöhnlich aber bezahlt man hier, wenn man keinen Tauschhandel betreibt, mit Flinten- oder Pistolenkugeln. So haben wir denn zum Tausche für Sotiro eine Munitionskiste und ferner mehrere Ballen indischen Katuns und ein Säckchen böhmischer Glasperlen im Gepäck: und – wenn das nicht reichen sollte – einen unbegrenzten Vorrat an Beredsamkeit. Vielleicht läßt Mkuënda, der König von K’elafo, sich ja vom Vorteil einvernehmlicher und langfristiger Handelsbeziehungen überzeugen, während ein einmaliger Ranzion, wie hoch er auch immer ausfallen mag, irgendwann verbraucht sein wird und im Übrigen nur unberechenbare Feinde schafft.
Hier in Bubassa werden wir endlich unsere Missionsbrüder los und können in kleinerer Schar der Auslösung Sotiros entgegeneilen. Am Erer-Fluß wartet Scheich Omar mit seinen Männern auf uns, um uns bei den Verhandlungen mit Häuptling Mkuënda beizustehen. Und in Fiq werden wir dann endlich auch M. Brémond und seine Kamelkarawane zurücklassen. Von nun an werden wir Unbekanntes erforschen, in die Territorien der Aroussi und Itou, ins Elfenbeinland vordringen, womöglich neue Märkte erschließen.
Das bucklige Pflaster, der narbige Putz der schiefen Fassaden, der Ziegeldunst, durchmischt von den Miasmen aus dem Untergrund, den Kloaken der Hauptstadt, im Souterrain eine Pelznäherin, Ratten- und Hundefelle für die Nierengürtel der Gichtgeplagten, in den Kellern und Katakomben ein einziger riesiger Hundefriedhof: jedes zweite schwarzhaarige Gesicht kommt mir bekannt vor, aber sie gehen an mir vorbei, ohne mich zu grüßen.
Düstere Häuser, das Leben auf den Straßen kommt kaum dagegen an, man müßte die Höfe mit ihren Aborten nach außen kehren oder den Hauswartsfrauen ihre Katzen rauben: kein einziger Baum, an den man unbescholten pissen dürfte, die Hofeinfahrten wehren sich bereits mit ihrem bestialischen Gestank.
Ich stehe vor verschlossenen Türen; hätte meine eigene Matratze mitbringen müssen; starre den Frauen hinterher, die mit blutigen Messern und Walpenissen in den Händen Richtung Bastille stürmen: die Erinnerung, ein Raunen. Ich versuche, sie mit Bildern zu ersticken. Warum gibt es das nicht: ein farb- und klangloses Wort, nüchtern, kalt wie eine Zahl, unser Dasein zu beschreiben – wir müßten nicht mehr nach dem Sinn fragen.