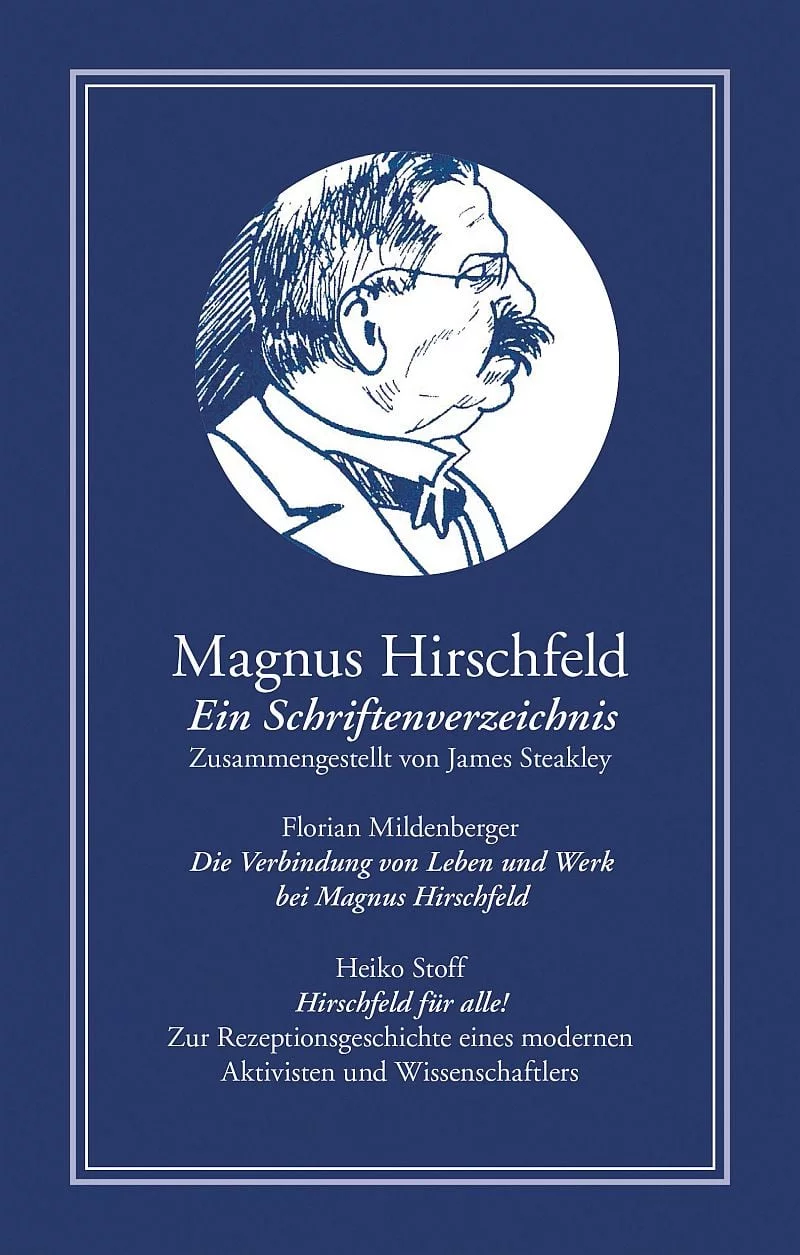
Magnus Hirschfeld: Ein Schriftenverzeichnis
Zusammengestellt von James Steakley
Gebunden, 256 Seiten
Veröffentlchung: September 2021
Magnus Hirschfeld: Ein Schriftenverzeichnis
1985 veröffentlichte James Steakley in einem schmalen Heft „The Writings of Dr. Magnus Hirschfeld“. Seitdem ist die Zahl der aufgefundenen Schriften enorm angewachsen. Steakley hat sie neu gesichtet, Verbindungen und Querbezüge aufgezeigt.
Zahlreiche kurze Zitate aus Büchern, Aufsätzen und Berichten veranschaulichen Hirschfelds Denken, seine Sprache und seine Argumentationsweise. Entstanden ist so eine Bibliographie, die zum Lesen und Stöbern einlädt. Komplett enthalten ist auch Hirschfelds Autobiographische Skizze, die er kurz vor seinem Tod auf Englisch verfasste und in der er nicht nur sein Lebenswerk beschreibt, sondern auch auf viele seiner Veröffentlichungen zu sprechen kommt.
Im Anhang beigefügt sind zwei ausführliche Studien über „Die Verbindung von Leben und Werk bei Magnus Hirschfeld“ (Florian Mildenberger) und „Zur Rezeptionsgeschichte Hirschfelds als eines modernen Aktivisten und Wissenschaftlers“ (Heiko Stoff).
BIOGRAFIE
JAMES STEAKLEY, Jahrgang 1946, lehrt German Cultural Studies an der Universität von Wisconsin. Er machte mit „The Homosexual Emancipation Movement in Germany“ seine Landsleute mit einem wichtigen Aspekt deutscher Geschichte bekannt. Als Amerikaner ist er bestens vertraut mit der deutschen Sprache und Kultur und konnte seinerzeit sowohl in der (alten) BRD und der DDR forschen und lehren. Steakley wurde, was man im Amerikanischen einen trailblazer nennt: Er ebnete den Weg für die akademische Sexualhistoriographie, wurde zu einem Anreger für die heute sogenannten Gender Studies.
LESEPROBE
AUSZUG AUS HEIKO STOFFS ANMERKUNGEN ZUR REZEPTIONSGESCHICHTE HIRSCHFELDS
HIRSCHFELD ALS TRANS- UND QUEERPIONIER
Während im deutschsprachigen Raum bis in die 1990er Jahre die Tendenz vorherrschte, Hirschfeld von seinen biologischen Grundlagen abzuspalten, existierte bereits in den 1950er Jahren in den USA und in Großbritannien ein Strang der Hirschfeld-Rezeption, der sich just auf dessen ätiologische Konzepte in Bezug auf Transvestitismus und Transsexualität bezog. Dies ergab sich zwanglos daraus, dass Hirschfeld aufgrund seiner gleichnamigen Publikation aus dem Jahr 1910 als Begriffsschöpfer des Transvestitismus anerkannt war und entsprechend für die immer notwendige Genealogisierung des neuen Forschungsgebietes aufgeführt wurde. Transvestitismus verstand Hirschfeld – gemäß jener Inversionslogik, nach der sich die Seele im falschen Körper befinden könnte, die Karl Heinrich Ulrichs formuliert hatte – als das innere Bedürfnis, sich konträrgeschlechtlich zu kleiden.
Er sprach auch von einem „Geschlechtsverwandlungstrieb“. Seinen ursprünglichen Forschungsansatz, der Transvestitismus auf Homosexualität zurückführte, ließ er aufgrund seiner Falluntersuchungen rasch fallen. Die meisten Transvestiten, so Hirschfeld, seien heterosexuell. Erklärbar war diese Praxis durch einen angeborenen, mithin unveränderbaren Trieb. Maßgeblich war die Individualität, die Seele oder eben die Identität. Allerdings, dies hat Darryl B. Hill herausgearbeitet, klassifizierte er die Aussagen der Betroffenen schließlich doch in einer Taxonomie, die, ohne dass dies durch die Fallstudien gedeckt war, einen spezifischen Typus konstituierte. Dies galt nicht nur für den Transvestitismus, sondern auch für den Hermaphroditismus sowie den mit dem Wunsch nach körperlicher Geschlechtsumwandlung verbundenen „extremen Transvestitismus“. Von „seelischem Transsexualisms“ sprach er erstmals 1923, ohne dies aber ebenso theoretisch einzurahmen.
Hirschfeld wurde in diesem Forschungsbereich also allein schon deshalb nicht vergessen, weil er qua Begriffsschöpfung einen neuen Forschungsgegenstand eingeführt hatte. Die noch junge Disziplin der endokrinologisch ausgerichteten Sexologie benötige ihn schlicht für ihre Genealogie. Kaum ein Beitrag zum Transvestitismus konnte in der Nachkriegszeit auf einen Verweis auf Hirschfeld verzichten, wobei es anfangs mit dem von Havelock Ellis geprägten Begriff des „Eonism“ durchaus ein konkurrierendes Konzept gab. Gerade weil Hirschfeld körperliche mit seelischen, somatische mit psychischen Prozessen enggeführt hatte, entsprachen seine Forschungsinhalte der psychoendokrinologischen Ausrichtung, wie sie in der Nachkriegszeit in den USA bedeutsam wurde.3 Grundsätzlich erschienen Transvestitismus und Transsexualität geprägt durch einen unaufhebbaren Trieb zum Wechsel des Geschlechts. Entsprechend konnte es therapeutisch beim Transvestitismus nicht um Heilung, sondern nur um Lebenserleichterung gehen, während bei Transsexualität – wie es dann Anfang der 1950er Jahre der dänische Endokrinologe Christian Hamburger aufsehenerregend bei Christine Jorgensen durchführte – die operative Angleichung des Geschlechtskörpers an die Geschlechtsidentität die einzige Option war.
In der Nachkriegszeit wurde die sexualwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Transsexualität und Transvestitismus zunehmend differenzierter. Die bedeutsamsten Vertreter in diesem Gebiet waren David Oliver Cauldwell und Charles V. Prince, später Virginia Prince. Cauldwell, der 1949 als erster den Begriff „Transsexualität“ systematisch verwendete, terminologisch aber eher an Krafft-Ebing anschloss, benutzte ihn auf pathologisierende Weise. Prince, die in den 1970er Jahren auch an der Etablierung des Begriffs „transgender“ beteiligt war, schrieb ausdrücklich als betroffene Person und arbeitete an einer Abgrenzung des Transvestitismus von Homosexualität und Transsexualität. Förderung erhielt Prince durch den Sexualmediziner Harry Benjamin, der schließlich als Hauptfigur der Transsexuellenforschung reüssierte. Benjamin betonte eine genetisch-hormonelle Prädisposition der Transsexualität. Eine psychotherapeutische „Normalisierung“ lehnte er strikt ab und setzte sich energisch für „conversion-operations“ ein. Der bis zum Ersten Weltkrieg in Deutschland lebende Benjamin war Teil des Hirschfeldschen Netzwerkes gewesen und hatte aktiv an den Tagungen der Weltliga für Sexualreform teilgenommen. Mit Steinach hatte er zudem eine intensive Korrespondenz gepflegt. In seinen Veröffentlichungen erinnerte er immer wieder an die Vorarbeiten Hirschfelds, vor allem in Bezug auf den Transvestitismus, und erklärte einem US-amerikanischem Publikum auch dessen Bedeutung für Kinseys bahnbrechende Forschungen.
Die Begriffsschöpfung „transsexualism“ beanspruchte er allerdings für sich. All diese Forschungen basierten auf einem klaren Zweigeschlechtermodell, wie es dann auch John Money, der dabei immer wieder auch auf Hirschfelds und Steinachs Vorarbeiten einging, bei seiner Konzeptualisierung der Intersexualität grundsätzlich verwendete: Das sexuelle System müsse als Differenzierung eines dimorphen Systems erklärt werden.
Hirschfeld war also in den USA in einem klinischen Bereich als Pionier etabliert, der im bundesdeutschen Streit um Hirschfeld eher ausgeblendet wurde. Während dort die Auffassung dominierte, dass die Psychoendokrinologie vor allem an der Normalisierung von Homosexualität interessiert sei, wurde Hirschfelds Bedeutung bei Geschlechtsumwandlungen von Trans- und Intersexuellen wenig thematisiert. In den 1990er Jahren, als über Trans- und Intersexualität, vor allem auch auf Druck der Betroffenen selbst, immer mehr diskutiert wurde, kam es jedoch zu einer historischen Aufarbeitung, bei der Hirschfelds Rolle deutlicher herausgearbeitet wurde. Dieser konnte nun als jemand charakterisiert werden, der auf sehr zeitgemäß erscheinende Weise von einer Geschlechteridentität ausging, die nicht pathologisiert werden durfte und von der Umwelt akzeptiert werden musste.
Geschichtswissenschaftliche Veröffentlichungen zum Transvestitismus oder Cross-Dressing erschienen vornehmlich im englischsprachigen Raum. Auch hier war es das Ziel, durch Historisierung zur Entpathologisierung beizutragen. Dem folgten, nachdem Vern L. Bullough bereits 1975 wichtige Vorarbeit geleistet hatte, in dichter Reihe Studien zur Geschichte der Transsexualität, die unisono Hirschfelds Forschungen würdigten. Der Fokus richtete sich dabei auf die Geschichte der Geschlechtsumwandlungsoperationen. Dies wurde vor allem anhand entsprechender Lebens- und Fallgeschichten aufgearbeitet.
Seit der Jahrtausendwende ist eine kaum noch zu überblickende Anzahl an Publikationen zu der 1907 veröffentlichten Autobiografie von N.O. Body als Geschichte unklarer Geschlechtsdiagnose bei Intersexualität erschienen. Die erste in der Öffentlichkeit ausführlich dargestellte geschlechtsangleichende Operation fand im Jahr 1930 statt, verwandelte Einar Wegener in Lili Elbe, wurde intensiv analysiert und schließlich 2015 als „The Danish Girl“ auch filmisch durchaus melodramatisch dargestellt. Da dabei Fragen der Materialisierung, der Geschlechtswerdung, der semiotisch-materiellen Verbundenheit im Mittelpunkt standen, wurde nicht nur der Sexualwissenschaftler Hirschfeld wiederentdeckt, sondern auch als früher Protagonist des „making sex“ neu interpretiert.2 Paul B. Preciado hat am deutlichsten die materialisierende Bedeutung der Steinach-Hirschfeldschen Lehre aufgezeigt, als er in dem 2008 zuerst auf Spanisch erschienenem Buch Testo Junkie sein Selbstexperiment der Geschlechtsverwandlung mittels Testosteron als eine Form der autonomen Subjektivierung unter den Bedingungen einer „pharmapornografischen“ Gesellschaft schilderte.
Der Essay bezog dabei auch immer wieder die Geschichte der Aktivierung hormoneller Agentien mit ein, bei der Hirschfeld und Steinach eine entscheidende Rolle zukommt. Geschlechtsumwandlungen wurden zu einer bedeutsamen Schnittstelle für jene Identitätsfragen, die seit den 1990er Jahren, nachdem sie eigentlich poststrukturalistisch dekonstruiert schienen, wieder neu diskutiert wurden. Hirschfeld wurde zu einem Akteur der Transgendergeschichte. Ebenso aber hatte er es mit der Zwischenstufenlehre möglich gemacht – J. Edgar Bauer wies unermüdlich darauf hin – die Einteilungsschemata „männlich“ und „weiblich“ für überflüssig zu erklären. Während Geschlechtsumwandlungen, so sie eine Inversion aufheben sollten, durchaus auf einem antagonistischen Konzept polarer Männlich- und Weiblichkeit beruhen konnten, verwies die Zwischenstufenlehre auf genderqueere Konzepte einer nonbinären Geschlechterordnung.
In beiden Fällen war Hirschfeld zu einer historischen Referenz geworden, vor allem auch deshalb, weil sein Name für eine Genealogisierung der Queer- und Transbewegung bedeutungsvoll war. Die Geschichte seines Instituts war der Beweis, dass queere Identitäten lange vor Eve Kosofsky Sedgwick und Judith Butler gelebt wurden. Ebenso verwiesen Geschichten wie die von Lili Elbe auf eine „Vorgeschichte“ der Transidentität. Allerdings wurde insbesondere die Steinach-Hirschfeldsche Lehre dabei im Hinblick auf die aktuellen Debatten gelesen und weniger in Bezug auf die spezifischen historischen Umstände der 1920er und 30er Jahre. Die Literaturwissenschaftlerin Heike Bauer zeigte anhand ihrer Arbeit mit dem verstreuten Nachlass Hirschfeld, dass dieser auch dafür genutzt werden kann, queere Lebensweisen und vor allem gegen sie gerichtete Gewalt überhaupt erst offenzulegen. Wenn sie sich damit auch keineswegs einer eher optimistischen Genealogie anschloss, konstatierte auch sie eine moderne queere Kultur, zu der Hirschfeld unbedingt dazugehöre.
Auszug aus „Hirschfeld für alle! – Zur Rezeptionsgeschichte eines modernen Aktivisten und Wissenschaftlers“ von Heiko Stoff