HOME / Buch / Mayaoglu/Nadia
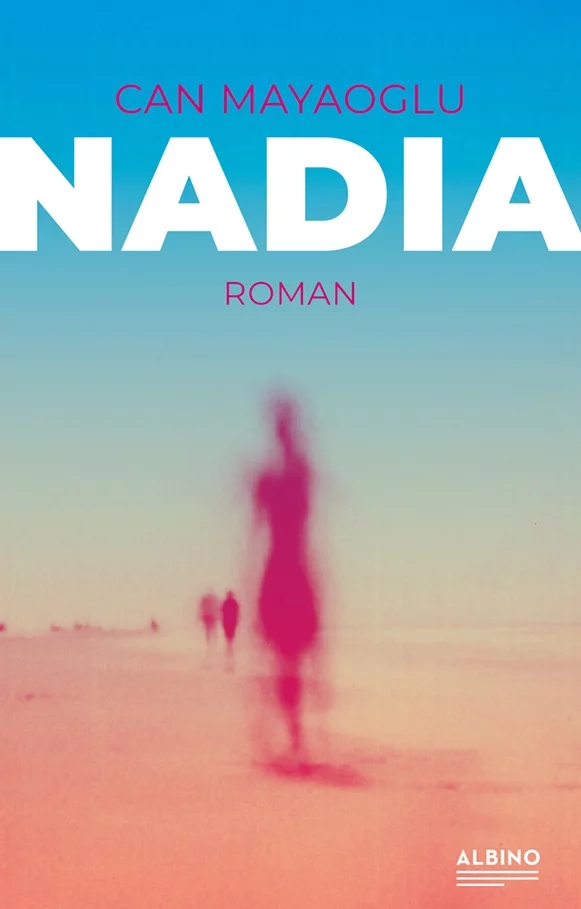
Nadia
von Can Mayaoglu
Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen, 262 Seiten
Veröffentlichung: 11. April 2023
Nadia
Nach fünf Jahren Jetset rund um die Welt kehrt die Künstlerin Nadia Kartal in ihre Heimatstadt Hamburg zurück, um dort ihre international erfolgreiche Installation STIP (So This Is Permanence) zu präsentieren – ein Werk, das der Erinnerung an ihre spurlos verschwundene Schwester Dilhan gewidmet ist. Kritik und Publikum lieben STIP, doch der Trost, den die Allgemeinheit in der Installation findet, kommt bei Nadia nicht an. Ihr innerer Aufruhr bleibt. Bei der Rückkehr nach Hamburg zählt sie darauf, dass ihre jahrelang eingeübten Fluchtmechanismen sie auch diesmal vor aufrüttelnden Konfrontationen bewahren werden. Doch hier, wo das Trauma seinen Ursprung hat, ist die Erinnerung stärker als die Verdrängung. Und dann ist da noch das Wiedersehen mit jener Person, wegen der Nadia vor fünf Jahren Hals über Kopf aus Hamburg geflohen ist: ihre große Liebe Rahel.
Anhand eines berührenden Künstlerinnenporträts erzählt „Nadia“ von den vielen Ausdrucksformen der Liebe. Mit treffsicherem Gespür für Milieus und Stimmungen lässt Can Mayaoglu den Charakter, das Werk, das Umfeld und die Ängste ihrer Titelheldin greifbar werden. Ihr Debütroman beschwört die Macht der Erinnerungen, aber auch die heilenden Kräfte der Selbstakzeptanz, der Freundschaft und der Kunst. Ein eindringlicher, feinfühliger Roman, der auch wegen seines starken „Soundtracks“ im wörtlichen Sinne lange nachklingt.
BIOGRAFIE
CAN MAYAOGLU, Jahrgang 1982, ist in Münster (Westfalen) in einem deutsch-türkischen Psycholog*innen-Haushalt aufgewachsen. Sie studierte Religionswissenschaft und arbeitet neben dem literarischen Schreiben als Buchhändlerin und Autorin für Print- und Onlinemedien. „Nadia“ ist ihr erster Roman. Can Mayaoglu lebt in Hamburg.
LESEPROBE
AUSZUG AUS „NADIA“ VON CAN MAYOGLU
Wie betäubt saß Nadia an ihrem Platz. Sätze fielen, Geschirr klapperte, Hände gestikulierten, doch all das schien in einer Ferne stattzufinden, die für sie nicht erreichbar war. Sie beobachtete alles, aber sah nichts, hörte alles, aber verstand nichts. Sprach jemand sie an, war es eine Fremde, die mit ihrer Stimme antwortete. Während sie einen Bissen in den Mund schob und kaute, ohne etwas zu schmecken, erklang hinter ihr ein undeutliches Gemurmel. Sie sah sich um. Da war niemand. Aber das Murmeln blieb. Es schien ihr etwas zuzuflüstern. Etwas, das sie vergessen hatte, nun aber allmählich in ihr Gedächtnis zurückdrängte. Nadia begann zu schwitzen, erinnerte sich, schaffte es nach und nach, den Singsang einzuordnen.
Die Verse polterten in ihr Bewusstsein wie zentnerschwere Felsblöcke: „Aus! Kleines Licht! / Leben ist nur ein wandelnd Schattenbild; / Ein armer Komödiant, der spreizt und knirscht / Sein Stündchen auf der Bühn’ und dann nicht mehr / Vernommen wird.“ Dilhan hat sich in der Schultheatergruppe durchgesetzt. Sie darf in der jährlichen Aufführung Macbeth spielen und dem zum Größenwahn Verführten ihr Gesicht, ihre Stimme, ihren Körper leihen. „Ein Märchen ist’s, erzählt / Von einem Dummkopf, voller Klang und Wut / Das nichts bedeutet.“ Stundenlang läuft Dilhan durchs Haus und übt so lange diese Stelle, bis auch Nadia sie nicht mehr aus dem Kopf bekommt: „Ein Märchen ist’s, erzählt / Von einem Dummkopf, voller Klang und Wut / Das nichts bedeutet.“
Als Dilhan zu Hause übt, will sie Nadia dazu verdonnern, Lady Macbeth zu sprechen. Nadia protestiert. Mit Lady Macbeth kann sie sich nun wirklich überhaupt nicht identifizieren. Dilhan fährt sie entnervt an: „Du kannst doch wenigstens mal so tun!“ Doch Nadia streikt. Was dieses herrschsüchtige Weibsbild ihrem labilen Gatten ins Hirn pflanzt, ist ihr so wesensfremd, dass sie sich weigert. Daraufhin rennt Dilhan zu Minoo: „Kannst du Lady Macbeth für mich sprechen? Nadia will nicht. Sie schafft es nicht, ihren Hamlet-Komplex zu überwinden.“ Nadia steht unten an der Treppe und hört alles mit an. „Lass gefälligst Hamlet aus dem Spiel, ist das klar?“, ruft sie nach oben. „Du musst einfach mal akzeptieren, dass Shakespeare auch noch andere Figuren geschaffen hat als Hamlet, diesen endlosen Gedankenkreislauf in Menschengestalt“, ruft Dilhan zurück. „Im Gegensatz zu Macbeth ist Hamlet wenigstens vielschichtig und komplex. Macbeth ist einfach nur zu doof für die eigene Position, mit dem will ich nichts zu tun haben.“ Danach knallen die Türen, alle schmollen und Nadia wird Dilhans Schulaufführung nicht besuchen. Auch sonst wird sie nie eine Macbeth-Inszenierung besuchen, geschweige denn den Text lesen. Aber sie wird die Verse in STIP einbauen. Ganz klein, kaum lesbar, als würde sie sich ihrer schämen, schlängeln sie sich als Schriftband unter einer Reihe von Dilhan-Fotos entlang.
Nadia wollte einen Schluck trinken, doch als sie das Glas zum Mund führte, stellte sie fest, dass es leer war. Während sie noch stutzte, kam schon jemand und füllte es auf. Das war keine der Aushilfen. Das war Rahel. Plötzlich bekam Nadia Panik. Sie dachte: „Du darfst nicht noch mal aus meinem Leben verschwinden, ein zweites Mal packe ich das nicht.“ Gleichzeitig rief eine andere Stimme in ihr: „Rede mit ihr. Du kannst das. Du kannst mit ihr reden. Dies ist nicht das Damals, dies ist das Jetzt.“ Und Nadia hörte sich selbst sagen: „Danke.“
Rahel setzte sich neben sie: „Sie heißen Ella und Nadia.“ Nadia konnte nicht folgen. „Meine Töchter, sie heißen Ella und Nadia. Dass eine von den beiden nach dir benannt ist, war ehrlich gesagt Naels Idee. Er meinte, nur weil unser Ende ein Desaster war, muss das nicht unsere gemeinsame Zeit zunichtemachen. Er fand die Idee schön, dass wir, wenn unsere Tochter irgendwann mal fragt, nach wem sie benannt ist, sagen können: ‚Nach einer Frau, die eurer Mutter sehr viel bedeutet hat.‘“ Nadia musste schlucken. „Du bedeutest mir auch jetzt noch viel, Nadia. Das wirst du immer tun. Su-Lin und Minoo wissen das, ich habe es ihnen oft gesagt. Aber sie mussten mir versprechen, dir das nicht zu erzählen. Weil ich es dir selbst sagen wollte. Ich wusste immer, dass irgendwann eine Gelegenheit dafür kommen würde.“ Nadia schloss für einen Moment die Augen. Sie versuchte das, was Rahel gerade gesagt hatte, zu verstehen, zu fühlen, zu glauben.
Als sie die Augen öffnete, lächelte Rahel sie aufmunternd an: „Du hast gedacht, ich hasse dich? Wie sollte ich dich hassen können? Wir haben wunderschöne Jahre miteinander geteilt, warum sollte ich mir die Erinnerung daran durch Hass vergiften?“ – „Er muss ein sehr besonderer Mensch sein, dein Nael. Kein Hamlet, kein Macbeth.“ Natürlich verstand Rahel die Anspielung. Nadia sah es an Rahels Blick. „Nein, da hast du recht. Nael ist eher ein Enzo Scanno. Er ist freundlich, liebevoll, zuvorkommend. Er hat mal zu mir gesagt, er versuche immer freundlich zu sein, weil er hofft, dadurch Menschen, die ihren Glauben an die Freundlichkeit verloren haben, ein Stück dieses Glaubens zurückgeben zu können. Und dass ihm das genüge. Er reflektiert sich selbst und seinen Standpunkt in dieser Welt. Aber nicht aus überzogener Ich-Bezogenheit. Sondern um der Welt willen.“ – „Ganz anders als ich, oder?“ Diese Bemerkung konnte sich Nadia nicht verkneifen. „Ach, weißt du. Du bist so lange im Krieg mit dir selbst gewesen, dass du deine eigene Not nicht mehr gesehen hast.“
Minoo und Su-Lin führten einen regelrechten Tanz auf beim Versuch, Nadia und Rahel möglichst unauffällig zu beobachten. Jacques und Jean wiederum beobachteten Minoo und Su-Lin, zunächst amüsiert, dann kopfschüttelnd. Als es Jacques zu bunt wurde, griff er Minoo am Arm und zog sie in die Küche. „Das reicht jetzt mal. Ihr führt euch ja auf wie pubertierende Teenager.“
Minoo blickte ihren Mann entgeistert an. Erst wollte sie protestieren, dann begriff sie, dass er recht hatte. Sie errötete, schlug sich die Hände vors Gesicht und schüttelte lachend ihren Kopf: „Oh Gott, wie peinlich. Wirklich, wie peinlich.“ In diesem Moment betrat Jean die Küche. Als er Minoo und Jacques sah, blieb er abrupt stehen. Es war nicht das erste Mal, dass er die beiden versehentlich in einem Moment antraf, in dem sie nicht nur Schwägerin und Bruder waren, sondern Frau und Mann, zwei Menschen, die seit Jahren Bett und Gedanken miteinander teilten, deren Vertrautheit sich nicht nur darin äußerte, dass sie einander auch ohne Worte verstanden, sondern sich bis in die kleinsten, unscheinbaren Gesten, Berührungen und Blicke fortsetzte.
Für Jean waren solche Momente immer wie ein kleiner Stich gewesen, auch wenn er stets versucht hatte, sie nicht überzubewerten. Doch diesmal war etwas anders. Er hatte etwas gesehen, was er nicht sehen wollte. Etwas begriffen, was er nicht begreifen wollte. Er drehte sich um, ging durch den Flur zum Gästezimmer, in dem die Jacken, Schals, Mützen und Handschuhe der Gäste abgelegt waren, und suchte seinen Mantel. Als er ihn endlich fand, hielt er kurz inne, fischte den Autoschlüssel aus seiner Hosentasche, drehte ihn zwischen den Fingern und wusste, dass er nicht länger bleiben konnte.
Er fühlte sich, als hätte Gott ihn in jener Sekunde, in der er Minoo seinen Bruder in der Küche mit diesem besonderen Ausdruck in ihren Augen hatte anblicken sehen, mit dem Kainsmal gezeichnet. Dass er diesen Blick kannte, dass er selbst hunderte Male mit ihm angesehen worden war, begleitet von Küssen, Zärtlichkeiten und leisem Flüstern, empfand er an diesem Abend nicht als Trost, sondern als große Demütigung. Jean zog den Mantel über und verließ fluchtartig die Wohnung, ohne sich von irgendjemandem zu verabschieden.
Er setzte sich ins Auto, legte die Hände aufs Lenkrad, atmete schwer und starrte in die Dunkelheit. Da klopfte es plötzlich an die Scheibe der Fahrertür. Erstaunt sah Jean zur Seite. Draußen stand Nadia. Als er die Scheibe herunterließ, sah sie ihm ernst ins Gesicht und forderte ihn mit einer Handbewegung auf, auszusteigen. „Du musst nichts sagen. Aber lässt du bitte mich fahren?“